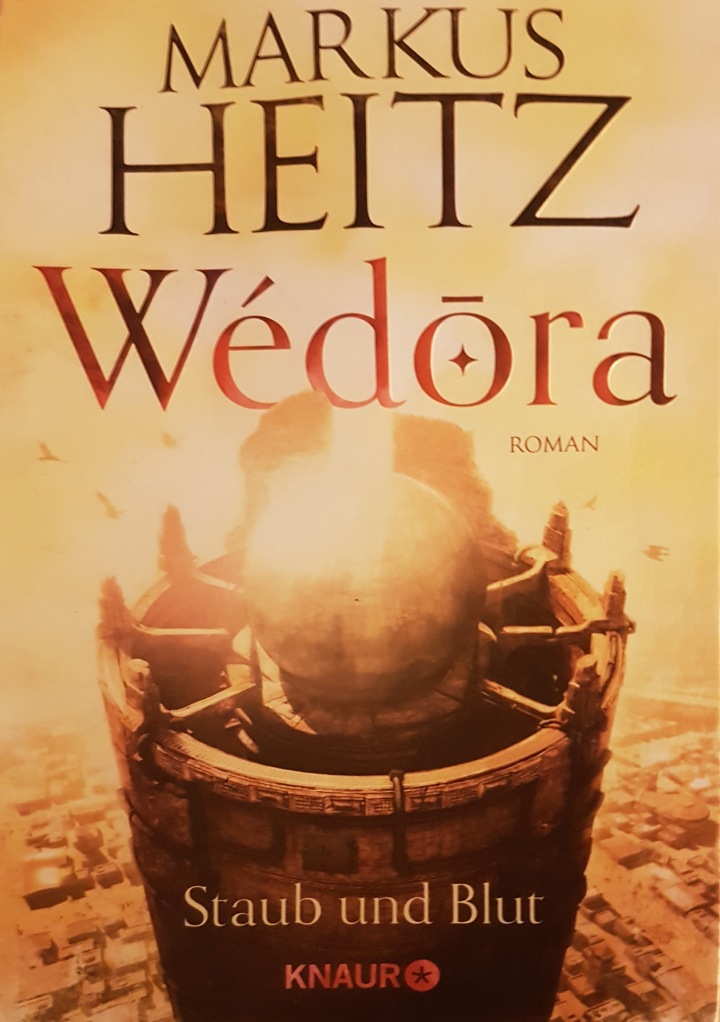Ich habe ein ganz besonderes Bücherregal.
Es ist kein materielles Bücherregal aus Holz, sondern mehr ein virtuelles Bücheregal. Es steht in meinem Kopf, und es enthält Bücher. Die Anzahl Bücher, die darin „steht“ ist überschaubar.
Manche Bücher sind für mich sehr einprägsam. Seiten, ganze Kapitel, oder sogar der vollständige Text brennen sich dann ins Gedächtnis ein, sodass ich tatsächlich später einfach „im Kopf“ das Buch wieder aufblättern und lesen kann.
Dabei sind das nicht immer unbedingt die Bücher, die mir am besten gefallen. Genau genommen, habe ich keine Ahnung, was der Auslöser ist, dass manche Texte sich einfach Bild für Bild abrufbar abspeichern und andere nicht.
Obwohl ich viel lese, bekommt dieses Bücherregal nicht besonders oft Zuwachs. Es können Jahre vergehen, bevor ich wieder ein Buch finde, das in dieses „Regal“ rutscht.
Seit dieser Woche habe ich nun ein neues Buch dort stehen. Während, wie gesagt, nicht jedes so gespeicherte Buch zu meinen Lieblingsbüchern gehört – dieses tut es definitiv.
*

„Shades of Grey“ hat nichts mit „50 Shades of Grey“ zu tun. Es ist ein Buch von Jasper Fforde, und wer mit Ffordes Werken vertraut ist, kann sich schon vorstellen, welche Art von Buch es ist. Fforde war Kameraassistent für James Bond: GoldenEye und dürfte im Literaturbereich am besten für seine „Thursday Next“-Serie bekannt sein (Gruß an den Kollegen, der die ins Deutsche übersetzt hat: Sie haben ja nicht mal ernsthaft VERSUCHT, den Büchern gerecht zu werden…).
Nun. Shades of Grey heißt auf Deutsch „Grau“, ist im Eichborn-Verlag erschienen und ich habe es in Übersetzung nicht gelesen. Daher kann ich mich leider nicht dazu äußern, wie gut oder schlecht diese ist. Die Buchausgabe ist vergriffen, Kindle benutze ich nicht. Ich hoffe, dass hier ein Übersetzer dran war, der sein Handwerk wirklich versteht – das Buch ist meiner Einschätzung nach extrem schwer zu überestzen, wobei ich mir vorstellen kann, dass eine sorgfältige Übersetzung auch wahnsinnig viel Spaß machen könnte. Wenn jemand die deutsche Fassung kennt, darf er mir gerne mitteilen, ob sie was taugt! Nachfolgend sind alle übersetzten Begriffe daher nur meine eigenen Übertragungen aus dem Originaltext!
Das Setting ist erst mal ordentlich bizarr. Wir befinden uns weit in der Zukunft. Etwa 500 Jahre vor der Geschichte, die erzählt wird, passierte Etwas. Was genau? Weiß keiner. Geschichte wurde abgeschafft, wie eigentlich die allermeisten Fakten. Wilde Spekulation ist eher „in“.
Die Menschen leben im „Kollektiv“ – das anscheinend speziell die britischen Inseln überzieht. Die Bevölkerungszahlen werden streng kontrolliert. Fortpflanzen ist nur mit Erlaubnis möglich. Man lebt nach einem strengen Regelwerk. Einige der Regeln sind recht sinnvoll – etwa lautet Regel 1, dass man nichts tun darf, das einem anderen Menschen schadet. Andere muten genauso bizarr an, wie die Welt an sich, wieder andere sind einfach nur zum-sich-wegwerfen komisch. Regel 9.3.88.32.025 etwa besagt: Die Gurke und die Tomate sind Obst, die Avocado ist eine Nuss. Um eine ausgewogene Ernährung für Vegetarier sicherzustellen, ist das Huhn am ersten Dienstag des Monats offiziell Gemüse.
Klingt soweit noch nach „Ach, wieder irgendeine Dystopie, was ist daran so ungewöhnlich?“
Na, es wäre nicht Fforde, wenn es nicht ein bisschen ins surreale anmutende ginge.
Die Menschen dieser Zeit sind alle mehr oder weniger Farbenblind. Die gesamte Gesellschaft basiert ausschließlich darauf, welche und wie viele Farben der einzelne sieht. Im Alter von 20 Jahren wird jeder auf Farbsehen geprüft und erhält dann seine Einstufung. Karriere, soziales „Standing“, Heiratsaussichten – alles hängt davon ab. Die „Grauen“ sind die Arbeiter- und Dienerklasse. Leider gibt es davon immer weniger, weil die „farbigen“ Familien alles tun, um ihr Farbsehen nicht zu verlieren. So sind die Grauen allgemein überarbeitet. Immerhin können sie so mehr verdienen, meint jemand im Buch. Leider nutzt ihnen das nichts. Sie können zwar so viel verdienen, wie sie wollen, aber die Beträge, die sie ausgeben dürfen, sind begrenzt.
A propos – diese Welt hat zwei Währungen: Merits und Cents. Merits werden zum Handeln verwendet, aber auch als Belohnung für gutes Verhalten vergeben… oder zur Strafe abgezogen. Sinkt der Meritstand zu tief, heißt es ab zur Umerziehung.
Zurück zu den Farben… unter den Farbsehenden fängt die Hierarchie unten mit rot an und hört oben mit lila auf. Nachnamen weisen immer auf die Farbe und die Intensität des Farbsehens hin. Durch Heirat kann der „tiefer“ eingestufte Partner in die Farbe des „höher“ eingestuften umklassifiziert werden. Theoretisch könnte man so direkt von Grau zu Lila werden – jedoch kommt eine solche Verbindung eher selten vor. „Wenn du willst, dass deine Nachfahren dich hassen,“ heißt es nämlich, „dann heirate spektrumabwärts.“
Dieses eingeschränkte Farbsehen gilt jedoch nur für natürliche Farben – und alten Farben, aus der Zeit bevor Etwas Passiert ist. Andererseits jedoch kann aus altem eingefärbtem Kunststoff künstliches Pigment extrahiert werden, mit dem „Univision“ – für alle sichtbare – Farben erzeugt werden können. Reiche Familien kaufen sich dann eingefärbte Möbel, eingefärbtes Essen, etc., damit jeder, der zu Besuch kommt, auch sieht, wie reich man eben genau ist.
Daneben werden Farben auch zu ganz anderen Zwecken verwendet: Als Drogen etwa (vor allem Grüntöne) oder zu medizinischen Zwecken. Manche Farben sind so gefährlich, dass sie verboten sind. Es heißt sogar, es gäbe irgendwo ein Gebäude, das in einer Farbe gestrichen ist, die den Betrachter durch bloßes Ansehen tot umfallen lässt.
Das Regelwerk ist unfehlbar und enthält unter anderem eine Liste der Gegenstände, deren Produktion zulässig ist. Der Löffel fehlt dort, und so haben sich die Löffel inzwischen zu einer seltenen Ware entwickelt. Wer einen hat, trägt ihn vorzugsweise am Körper, um Diebstahl zu verhindern. Wer zwei hat, hat auf jeden Fall eine sehr gute Verhandlungsposition, könnte er doch einen eintauschen.
Was nicht in den Regeln steht, gilt als Apokrypha und wird wegignoriert. So etwa der „Gefallene“ – ein Mann, der an einen Stuhl aus Metall gefesselt vom Himmel gefallen und beim Aufprall verstorben ist. Der liegt noch immer – inzwischen ist kaum mehr als das Skelett übrig – genau da, wo er gelandet ist. Da er nicht offiziell existiert, kann ihn auch keiner wegräumen oder recyceln.
Diese Vorgehensweise führt dann auch zu interessanten Situationen, wenn man einen „apokryphen“ Menschen im Dorf hat, der lustig ins Zimmer spaziert kommt, das Abendessen mitnimmt und sich wieder verzieht… darf man doch nicht mal zugeben, ihn gesehen zu haben. So bleibt dann nur der Seufzer „Niemand hat gerade unsers Suppe gegessen…“ und die Suche nach einem Ersatz für die ausgefallene Mahlzeit.
In dieser Welt gibt es neben dem angeblich tödlich gestrichenen Gebäude ein paar sehr typische Todesformen: Schwäne sind sehr gefährlich. Insbesondere gilt dies für die Riesenschwäne. Dabei handelt es sich um extrem große fliegende Vögel, die scheinbar keine Beine haben, nie im gelandeten Zustand entdeckt werden, nicht mit den Flügeln schlagen müssen, und in sehr großer Höhe kreisen. Wie groß diese Tiere tatsächlich sind, ist schwer zu sagen – schließlich dürfte noch keiner eine direkte Begegnung überlebt haben.
Blitze sind ebenfalls sehr gefährlich, und die einzelnen Ortschaften bauen unterschiedlichste Mechanismen, um sie einzufangen und ihre Bewohner zu schützen. Insbesondere Kugelblitze gelten als tödlich und hinterhältig.
Mit dem Farbsehen ist die Fähigkeit verlorengegangen, die Pupillen zu erweitern um bei geringem Lichteinfall zu sehen. Die Nacht an sich ist daher ebenfalls sehr gefährlich – wer sich nach Einbruch der Dunkelheit außerhalb der sicher beleuchteten Gebiete aufhält, überlebt dieses Erlebnis nur selten.
Dennoch – die häufigste Todesursache ist eine Krankheit namens Mildew („Mehltau“); die ersten Symptome sind taube Ellenbogen und schnell wachsende Fingernägel. Wer betroffen ist, verabschiedet sich von seiner Familie und begibt sich in den „Grünen Saal“ – wo er durch medizinisches Grün in einen Zustand der Verzückung versetzt wird und schließlich verstirbt. Dann wird die Leiche versiegelt, denn Mehltauopfer husten einige Stunden nach dem Tod noch einmal und stoßen dabei Sporen aus, die die Krankheit weiter verbreiten. So ziemlich jeder, der nicht einem Schwan oder Blitz zum Opfer fällt, oder in der Nacht verloren geht, holt sich irgendwann den Mehltau und ist nach spätestens 24 Stunden tot.
Der Mehltau hat auch noch ein paar andere interessante Eigenschaften – so gibt es etwa eine Variante, die umgehend auftritt, wenn sich eine Person eine irreversible Verletzung zugezogen hat – traumatischer Mehltau nennt man das. Und es scheint dass der „Pöbel“ – Menschen, die unzivilisiert außerhalb der Städte in der Wildnis leben – dagegen auch noch immun sind. Sehr seltsam…
Zu irgendeinem Zeitpunkt wurde wohl – so nimmt man an – das genetische Material von Tieren und Pflanzen so verändert, dass diesen nun jeweils ein Strichcode irgendwo im Fell oder auf der Haut wächst. Strichcodes sammeln und entschlüsseln ist ein beliebtes Hobby – es ist übrigens Pflicht, mindestens ein Hobby zu haben, ebenso, wie es Pflicht ist, ein Instrument zu spielen. Fast alles hat Strichcodes: Rennschnecken, Bisons, Strauße, Giraffen, das Letzte Kaninchen… wenige Dinge haben keine, wie etwa Rhododendrons und Äpfel. Menschen… haben einen. Er wächst anstelle eines Fingernagels an der linken Hand.
In diese Welt wirft uns Fforde nun also gemeinsam mit Eddie, dem Erzähler und Protagonisten, direkt in die Verdauungskapsel einer fleischfressenden Pflanze – denn dort steckt er gerade. Während er darauf wartet, verdaut zu werden, erzählt er uns genau, wie er in diese missliche Lage genommen ist. Dabei schafft Fforde es, die Welt in der Erzählung vorzustellen, ohne in „Achtung, hier kommt eine Erklärung“ zu verfallen. Die Figuren sind teils sehr seltsam, aber innerhalb der Welt konsistent. Manches erscheint komischer als es müsste – was nicht die Schuld des Autors ist, sondern im Gegenteil an der Konditionierung des Lesers liegt. Die Sache mit der Mitgift und den arrangierten Ehen etwa wirkt gefühlt erst dann ganz besonders seltsam, wenn es der junge Mann ist, der quasi an die Familie seiner zukünftigen „Verkauft“ wird und auch noch einen Teil seiner eigenen Mitgift zu stellen hat. Da kann man als Leser dann trotz – oder vielleicht gerade wegen – der eher surrealen Umgebung eigene Annahmen etwas hinterfragen.
Fforde ist ein Meister der Beschreibungen auf einer Ebene, die mich zumindest sehr tief „erwischt“. So fiel mir etwa auf, dass ich alleine aufgrund der sehr farbspezifischen Wortwahl und der an die Wahrnehmung des Protagonisten angepassten Beschreibung nach Lektüre selbst die Farbigkeit um mich herum ganz anders – nicht intensiver, aber deutlich bewusster – wahrgenommen habe. Es war ein interessanter Effekt.
Was mir noch besonders gut gefällt ist, dass die Welt, egal wie bizarr, seltsam und unwahrscheinlich sie anmutet, am Ende Sinn gibt. Ich verstand die Lösung beim Lesen in einem Aha!-Moment einige Kapitel bevor die wichtigsten Punkte für den Erzähler selbst aufgelöst wurden. Es waren die Barcodes, die mich drauf brachten, zusammen mit den Schwänen und dem „Gefallenen“.
Sehr gut gefällt mir auch die Vielzahl der Anspielungen auf literarische Werke und alles von Musicals bis Brettspiele unserer Zeit. Oft lassen sich die Halb- und Falschüberlieferungen dann tatsächlich einsortieren. Das Buch hatte für mich keine Längen, keine echten Kopfschüttelmomente und keine Inkonsistenzen, die mit Blick auf die Auflösung nicht logisch sind. Es enthält natürlich ein paar Druckfehler, jedoch bietet Herr Fforde auf seiner Website neben etlichen Gimmicks auch ein Upgradecenter für seine Bücher an – detaillierte Anleitungen zur Beseitigung der gefundenen Druckfehler, sortiert nach Buch und Ausgabe, einschließlich einer Art Exlibris, das man sich ausdrucken und einkleben kann, und das darauf hinweist, dass das Buch nun die „vom Autor genehmigte Version 1.1“ sei. So trägt dann sogar das, was sonst eher nervig erscheint, zur Unterhaltung bei.
Jetzt müsste Herr Fforde nur dazu kommen, Band zwei und drei zu veröffentlichen. Da er ein sehr regelmäßiger Schreiber ist, habe ich hier jedoch volles Vertrauen darin, dass die Bände noch kommen. Für 2018 ist auf jeden Fall ein Buch aus dieser Welt angesagt, wenn auch eine Vorgeschichte, und noch nicht die Fortsetzung. Das Fforde-Buch von 2017 – der Autor veröffentlicht in schöner Regelmäßigkeit ein Buch pro Jahr – soll ein Standalone sein, das bereits vorbestellt ist.